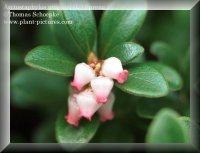|
Stammpflanze: Arctostaphylos uva-ursi (L.) SPRENG.
/ Bärentraube [Fam. Ericaceae / Heidekrautgewächse]. Synonyme: Arbutus uva-ursi L., Arctostaphylos media GREENE, Arctostaphylos officinalis WIMM., Arctostaphylos procumbens PATZKE,
Mairania uva-ursi DESV., Uva-ursi buxifolia S. F. GRAY, Uva-ursi procumbens MOENCH. Dt. Synonyme: Mehlbeere, Moosbeere,
Sandbeere, Wilder Buchsbaum, Wolfstraube. Englisch: Bearsgrape,
Mountain box, Red-berry, Redberried trailing Arbutus, Rockberry, Uplant
cranberry. |
|
Botanische Beschreibung der Stammpflanze: Kleiner Strauch mit niederliegenden, zu mehreren
aus einer Wurzel entspringenden, wurzelnden, reichverzweigten, bis 1 m langen Stämmchen
und Ästen, die nahezu rasenbildend sind. Die blütenlosen Äste flach ausgebreitet, die
blütentragenden aufsteigend. Blätter immergrün, ledrig, derb, ganzrandig, ca. 2 cm lang
und 1 cm breit, länglich-verkehrt eiförmig, oben breit gerundet, unten in den kurzen
Stiel verschmälert, oberseits dunkelgrün, unterseits blassgrün. Blüten kurzgestielt,
in wenigblütigen Trauben, mit kurzen, bis 1 mm langen Kelchblättern und ca. 6 mm langen,
verwachsenen, weißen oder rötlichen Kronblättern. |
|
Verbreitung: In Europa von Spanien und Italien bis zum
Nordkap und Island, im gemäßigter und Dauerfrostzone Asiens im Osten bis Ostsibirien, im
Süden bis in den Kaukasus, Altai und Himalaya, USA, Kanada, Guatemala. |
|
Droge: Die getrockneten, ganzen oder geschnittenen
Blätter, die bezogen auf die getrocknete Droge einen Mindestgehalt an
wasserfreiem Arbutin
von 7,0 % aufweisen (bestimmt mittels HPLC). |
|
Beschreibung der Droge:
Je nach Herkunft weisen die ledrigen und durch eine feine Netznervatur
gekennzeichneten Bärentraubenblätter eine relativ große Variabilität
auf. Die Oberseite der Blätter ist mehr oder weniger glänzend und
dunkel- bis gelblichgrün, die Unterseite matt und blassgrün. Weiterhin
können rötlichbraun verfärbte Blätter vorkommen. Die Blattspreite ist
mit Ausnahme sehr junger Blätter unbehaart, ganzrandig, spatelförmig
oder verkehrt eiförmig und etwa 0,7 bis 2,5 cm lang. Unten verschmälert
sich die Spreite in den ca. 1 bis 5 mm langen Blattstiel. |
| Geruch und Geschmack: Schwacher,
eigenartiger Geruch und zusammenziehender, schwach bitterer Geschmack. |
|
Synonyme Drogenbezeichnungen:
Deutsch: Achelblätter, Achelkraut, Bärenkraut, Moosbeerenblätter,
Sandblätter, Steinbeerenblätter, Wolfsbeerenblätter. Englisch: Bearberry
leaves, Ptarmiganberry leaves. Lateinisch: Folia Uvae-ursi. |
|
Herkunft: Aus Wildvorkommen besonders Spaniens, Italiens,
Tirols und der Schweiz, ferner Skandinaviens, Polens, Russlands und Bulgariens. |
|
Inhaltsstoffe: Durchschnittlich bis 12, gelegentlich bis
15 % Phenolglykoside, darunter insbesondere Arbutin
und, je nach Herkunft der Droge, nennenswerte Mengen an Methylarbutin, weitere
Hydrochinonderivate (Gallussäureester von Arbutin, freies Hydrochinon) nur in geringen
Konzentrationen. Ferner freie Gallussäure,
Flavonoide und Gallotannine. |
| Wirkungen: In vitro antibakterielle Aktivität
gegen verschiedene Mikroorganismen. |
|
Anwendungsgebiete: Entzündliche Erkrankungen der
ableitenden Harnwege. Zur Unterstützung bei der Therapie von Blasen- und
Nierenbeckenkatarrhen. In der Volksheilkunde zahlreiche weitere Anwendungsgebiete, bei
denen es sich um verschiedenste Erkrankungen des Urogenitaltraktes handelt. Für diese
Anwendungen fehlen jedoch wissenschaftliche Belege. |
|
Gegenanzeigen:
Während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 12
Jahren dürfen Bärentraubenblätter nicht angewendet werden. Ohne Rücksprache mit dem Arzt
keine lang andauernde Anwendung. |
Unerwünschte Wirkungen:
Bei magenempfindlichen Personen können Übelkeit und Erbrechen auftreten.
Bei Anwendung über einen längeren Zeitraum besteht die Gefahr des
Auftretens von Leberschäden. |
|
Wechselwirkungen: Keine gemeinsame Anwendung mit
Mitteln, die zur Bildung eines sauren Harns führen (Gefahr der
Wirkungsabschwächung bzw. des Wirkungsverlusts). |
|
Dosierung und Art der Anwendung:
Angewendet werden die klein geschnittene Droge und Drogenpulver für
Aufgüsse oder Kaltmazerate sowie unter standardisierten Bedingungen
hergestellte flüssige und feste Darreichungsformen. Soweit nicht anders verordnet beträgt die Einzeldosis 3
g Droge bzw. 100-210 mg Hydrochinon-Derivate, berechnet als wasserfreies
Arbutin. Die Anwendung sollte bis zu 4 x täglich erfolgen. Zur Teebereitung
3 g Droge mit ca. 150 ml kochendem Wasser übergießen und nach 15 min
durch ein Teesieb geben. Zur Herstellung eines Kaltwassermatzerats wird mit kaltem
Wasser übergossen und 6 bis 12 Stunden Ziehen gelassen. Zur Alkalisierung des Harns und
besseren Hydrochinonfreisetzung wird gleichzeitige Zufuhr von reichlich pflanzlicher
Nahrung oder gleichzeitige Gabe von Natriumhydrogencarbonat empfohlen. |
|
|
Literatur:
Europäisches Arzneibuch, 5. Ausgabe, Grundwerk 2005; Hagers Handbuch der pharmazeutischen
Praxis, Band 4, Drogen A-D, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1992; Köhler's
Atlas der Medizinal-Pflanzen, Band 1, Gera 1887; Monografie der Kommission
E, Bundes-Anzeiger Nr. 109 vom 15.06.1994. |